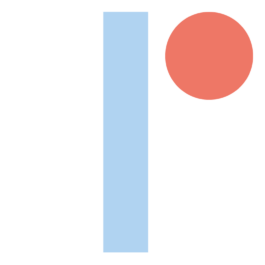
Fehler und Fehlleistungen
Das Richtige im Falschen
Freud, Fehler und Leistungen
In dem 1900 erstmals erschienenen Jahrhundertwerk Die Traumdeutung stellt Sigmund Freud, Vater der Psychoanalyse eindringlich dar, dass „es eine psychologische Technik gibt, welche gestattet, Träume zu deuten und [dass] bei Anwendung dieses Verfahrens jeder Traum sich als ein sinnvolles psychisches Gebilde herausstellt“ (Freud 1942, S. 1). Freud postuliert, dass es beim Traum neben dem manifesten Inhalt einen latenten Inhalt gibt, der mit Hilfe der freien Assoziation und der Deutung verstanden werden kann (vgl.ebd., S. 140).
Laplanche und Pontalis (1994) definieren beides wie folgt:

Manifester Inhalt: „Bezeichnet den Traum, bevor er der analytischen Untersuchung unterzogen wird,
so wie er dem Träumer erscheint, der daraus eine Erzählung macht“ (S. 302).

Latenter Inhalt: „Gesamtheit der Bedeutungen, zu der die Analyse einer Produktion des Unbewußten, besonders des Traumes, führt. Einmal entziffert, erscheint der Traum nicht mehr wie ein Bilderrätsel, sondern wie eine Organisation von Gedanken, wie eine Erzählung, die einen oder mehrere Wünsche ausdrückt“ (S. 277).
Die unbewusste Wunscherfüllung spielt bei unseren Träumen also eine wesentliche Rolle. Genauso verhält es sich auch bei den Fehlleistungen, welche auf einer unbewussten Ebene durchaus Sinn ergeben. In seiner Schrift Zur Psychopathologie des Alltagslebens aus dem Jahre 1904 beschreibt Freud, dass eine sogenannte Fehlleistung eine durchaus geglückte Handlung darstellt, in der sich ein unbewusster Wunsch erfüllt (vgl. ebd., S. 153). Er unterscheidet dabei das Vergessen, das Verlesen und Verschreiben, das Vergreifen, die Irrtümer, die Zufallshandlungen, sowie das Versprechen (Freud 1941,4 S.11 ff). Auf psychischer Ebene handelt es sich dabei um zwei Motive unterschiedlicher Systeme, die einen Kompromiss eingehen (vgl. Werner & Langenmayr 2005, S. 174). Werner und Langenmayr (ebd.) führen dazu aus, dass es sich „um ein unbewusstes Motiv des Es oder Über-Ich [handelt] und ein bewusstes des Ich oder Über-Ich. […] Der unbewusste Anteil an der Fehlleistung ist ein verdrängter Wunsch, der sich entgegen den Kontrollmechanismen von Ich und Über-Ich Geltung verschafft und von diesen Instanzen nicht restlos unterdrückt werden kann.“
Ähnlich wie beim Witz bringt die Fehlleistung eine vielleicht verpönte oder aggressive Ansicht mit einer geschickten Pointe ins Außen und trifft dabei unverhohlen eine versteckte Wahrheit. Dies ist einer der Gründe warum uns sowohl bei Witzen als auch bei Fehlleistungen so häufig zum Lachen ist. Freud hat diesem Thema im Band VI der gesammelten Werke Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten beachtliche Aufmerksamkeit geschenkt (Freud 1940. S. 7 ff.) Im Gegensatz zum Witz ist es allerding bei der Fehlleistung vor allem unser Unbewusstes, das die Pointe setzt und sich auf unsere Kosten einen Spaß erlaubt.
„when you mean one thing, …”
Abseits von der psychoanalytischen Theorie ist vor allem der freudian slip oder zu Deutsch der Freud’sche Versprecher allgemein bekannt geworden. In verschiedensten Kolumnen oder Beiträgen (wie beispielsweise in der Kolumne „Fehlleistungsschau“ der österreichischen Wochenzeitung Falter) wird zur Belustigung aller, regelrecht zur Schau gestellt, welche Missgeschicke den Menschen passieren. Vor allem in dem sonst so ernsten Tagesgeschäft der PolitikerInnen, belustigen Freud’sche Versprecher scheinbar ganz besonders.
Die deutschsprachige Website für Nachrichten des Magazins Focus nennt in einem Online-Artikel mit dem Titel "Die zwölf peinlichsten Versprecher von Politikern" unter anderem folgende Beispiele (Mrkaja 2013):
Obwohl es ihr doch eher selten passiert, ist auch […] Kanzlerin, Angela Merkel(CDU), schon mal ein freudscher Versprecher passiert, über den sich der ehemalige hessische Ministerpräsident sicherlich nicht gefreut hat: „Lieber Roland Kotz … ähm … Koch!“
Auch der französische Ex-Präsident, Nicolas Sarkozy, hatte schon damals etwas zum EU-Problemkind Griechenland zu sagen: „Natürlich wollen wir Griechenland im Euroraum behalten. Es wäre fatal, den Menschen dort das Gefühl zu geben, sie seinen Europäer.“
Der Ex-Doktor Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) argumentierte in der Bundestagsdebatte zu seiner abgekupferten Doktorarbeit leider mit einem Sprichwort, dessen genauen Wortlaut er wohl nicht kannte: „Ich schmücke mich nicht mit fremden Fehlern.“
Diese Beispiele zeigen, wie sehr Freuds Konzept der Fehlleistungen die Allgemeinbevölkerung abseits der Couch erreicht hat und wie sehr es durchaus zur Belustigung beiträgt, aufzudecken was gewissermaßen verdeckt bleiben sollte. Doch welche Relevanz hat dieses Konzept in der psychoanalytischen Behandlung?
Überlegungen für die psychoanalytische Praxis
Nachdem in den vorangegangenen Kapiteln Bezug auf die Theorie sowie auf die alltägliche Relevanz der Thematik genommen wurde, möchte ich nun einen Blick auf die psychoanalytische Praxis werfen. Die Psychoanalyse hat mit der Aufdeckung, der Bedeutung von Fehlleistungen, einen Beitrag zu einer erkenntnisorientierten Sicht auf Fehler geleistet (vgl. Schneider 2014, S. 16). Dabei beschäftigen wir uns in der Praxis vor allem mit der Frage, warum eine Fehlleistung gerade an dieser Stelle passiert. Doch neben dem tieferen Sinn, die eine Fehlleistung zu Tage bringt, lohnt sich meiner Meinung nach besonders ein Blick auf die Frage „wie sie das tut“. Die amüsanten Beispiele des dritten Kapitels verdeutlichen dabei, dass das Unbewusste nicht nur eine finstere und ernste Angelegenheit ist. Es zeigt sich, dass genau wie beim Traum eine äußerst kreative Leistung vollbracht wird, welche überraschende Sprünge vollführt. Die Lebendigkeit und Lebenskraft, wie wir sie auch im Humor vorfinden, ist Teil unseres Selbst. In der Therapie kann es dabei von besonderer Bedeutung sein, wieder einen Zugang zu dieser lebendigen und gewitzten Quelle zu finden. Diese Quelle dürfte beispielsweise bei einer Depression - bildlich gesprochen - unter Trümmern und Geröll verschüttet sein. Sie bedarf bestimmt einer behutsamen Begleitung, welche Schritt für Schritt, die einzelnen Elemente sichtet und durcharbeitet. Doch mit dem Blick und der Voraussicht, dass diese Quelle existiert und nicht versiegt, sondern lediglich verschüttet ist, lässt sich wohl mit Zuversicht auf die therapeutische Arbeit blicken. Aus diesen Gründen ist es ein Apell, die lebendigen Energien des Selbst zu würdigen und sich ihrer innewohnenden Kraft einmal mehr bewusst zu werden.
Ausblick
Auch wenn man hätte meinen können, dass mit der Karikatur zu Beginn inhaltlich schon alles gesagt sei, stellt sich doch heraus, dass es einen genaueren Blick bedarf. Selbst wenn neuere linguistische Theorien, die sich mit dem Versprechen befassen, vielleicht die psychoanalytische Betrachtung Freuds an einigen Stellen relativieren, bleibt dabei eines ganz bestimmt zu sagen: Sowohl die leichten und amüsanten Aspekte lohnen sich aufgegriffen zu werden als auch die Betrachtung der Chancen und Möglichkeiten, welche sich in der therapeutischen Praxis bieten. In diesem Sinne bleibt nur eines zu sagen: Es lohnt sich in jedem Fall die Aufmerksamkeit, wenn Peinliches zum Vorschwein kommt!
Literaturverzeichnis
Freud, S. (1941): Gesammelte Werke. Chronologisch geordnet. Vierter Band. Zur Psychopathologie des Alltagslebens. Über Vergessen, Versprechen, Vergreifen, Aberglaube und Irrtum. London: Imago Publishing Co., Ltd.
Freud, S. (1942): Gesammelte Werke. Chronologisch geordnet. Zweiter und dritter Band. Die Traumdeutung. Über den Traum. London: Imago Publishing Co., Ltd.
Kruska, L. (2018): Donald W. Winnicott – Good enough is good enough! In: A. Sreck-Fischer (Hg.): Die frühe Entwicklung. Psychodynamische Entwicklungspsychologien von Freud bis heute. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
Laplanche, J.; Pontalis, J.-B. (1994): Das Vokabular der Psychoanalyse. Frankfurt am Main: Surkamp.
Mrkaja, D. (2013, 19. Nov.): Die Zwölf peinlichsten Versprecher von Politikern. In: Fokus Online. https://www.focus.de/kultur/buecher/lieber-roland-kotz-aehmkoch-die-zwoelf-peinlichsten-versprecher-von-politikern_id_3111140.html [abgerufen am 15. Jänner 2022].
Werner, C.; Langenmayr, A. (2005): Der Traum und die Fehlleistungen. Psychoanalyse und Empirie. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
Scheider, G. (2014): Es gibt nicht das Wahre im Unwahren, wohl aber das Richtige im Falschen. Über Fehler, Probleme, die sie machen und Fehler-Leistungen in der Psychoanalyse. In: Ebrecht-Laermann, A.; Löchel, E.; Nissen, B.; Picht, J. (Hrsg.): Jahrbuch der Psychoanalyse. Beiträge zur Theorie, Praxis und Geschichte. Fehler und Fehlleistungen (S. 15-48). Stuttgart: frommann-holzboog Verlag.
Fehler und Fehlleistungen
Das Richtige im Falschen
Freud, Fehler und Leistungen
In dem 1900 erstmals erschienenen Jahrhundertwerk Die Traumdeutung stellt Sigmund Freud, Vater der Psychoanalyse eindringlich dar, dass „es eine psychologische Technik gibt, welche gestattet, Träume zu deuten und [dass] bei Anwendung dieses Verfahrens jeder Traum sich als ein sinnvolles psychisches Gebilde herausstellt“ (Freud 1942, S. 1). Freud postuliert, dass es beim Traum neben dem manifesten Inhalt einen latenten Inhalt gibt, der mit Hilfe der freien Assoziation und der Deutung verstanden werden kann (vgl.ebd., S. 140).
Laplanche und Pontalis (1994) definieren beides wie folgt:

Manifester Inhalt: „Bezeichnet den Traum, bevor er der analytischen Untersuchung unterzogen wird,
so wie er dem Träumer erscheint, der daraus eine Erzählung macht“ (S. 302).

Latenter Inhalt: „Gesamtheit der Bedeutungen, zu der die Analyse einer Produktion des Unbewußten, besonders des Traumes, führt. Einmal entziffert, erscheint der Traum nicht mehr wie ein Bilderrätsel, sondern wie eine Organisation von Gedanken, wie eine Erzählung, die einen oder mehrere Wünsche ausdrückt“ (S. 277).
Die unbewusste Wunscherfüllung spielt bei unseren Träumen also eine wesentliche Rolle. Genauso verhält es sich auch bei den Fehlleistungen, welche auf einer unbewussten Ebene durchaus Sinn ergeben. In seiner Schrift Zur Psychopathologie des Alltagslebens aus dem Jahre 1904 beschreibt Freud, dass eine sogenannte Fehlleistung eine durchaus geglückte Handlung darstellt, in der sich ein unbewusster Wunsch erfüllt (vgl. ebd., S. 153). Er unterscheidet dabei das Vergessen, das Verlesen und Verschreiben, das Vergreifen, die Irrtümer, die Zufallshandlungen, sowie das Versprechen (Freud 1941,4 S.11 ff). Auf psychischer Ebene handelt es sich dabei um zwei Motive unterschiedlicher Systeme, die einen Kompromiss eingehen (vgl. Werner & Langenmayr 2005, S. 174). Werner und Langenmayr (ebd.) führen dazu aus, dass es sich „um ein unbewusstes Motiv des Es oder Über-Ich [handelt] und ein bewusstes des Ich oder Über-Ich. […] Der unbewusste Anteil an der Fehlleistung ist ein verdrängter Wunsch, der sich entgegen den Kontrollmechanismen von Ich und Über-Ich Geltung verschafft und von diesen Instanzen nicht restlos unterdrückt werden kann.“
Ähnlich wie beim Witz bringt die Fehlleistung eine vielleicht verpönte oder aggressive Ansicht mit einer geschickten Pointe ins Außen und trifft dabei unverhohlen eine versteckte Wahrheit. Dies ist einer der Gründe warum uns sowohl bei Witzen als auch bei Fehlleistungen so häufig zum Lachen ist. Freud hat diesem Thema im Band VI der gesammelten Werke Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten beachtliche Aufmerksamkeit geschenkt (Freud 1940. S. 7 ff.) Im Gegensatz zum Witz ist es allerding bei der Fehlleistung vor allem unser Unbewusstes, das die Pointe setzt und sich auf unsere Kosten einen Spaß erlaubt.
„when you mean one thing, …”
Abseits von der psychoanalytischen Theorie ist vor allem der freudian slip oder zu Deutsch der Freud’sche Versprecher allgemein bekannt geworden. In verschiedensten Kolumnen oder Beiträgen (wie beispielsweise in der Kolumne „Fehlleistungsschau“ der österreichischen Wochenzeitung Falter) wird zur Belustigung aller, regelrecht zur Schau gestellt, welche Missgeschicke den Menschen passieren. Vor allem in dem sonst so ernsten Tagesgeschäft der PolitikerInnen, belustigen Freud’sche Versprecher scheinbar ganz besonders.
Die deutschsprachige Website für Nachrichten des Magazins Focus nennt in einem Online-Artikel mit dem Titel "Die zwölf peinlichsten Versprecher von Politikern" unter anderem folgende Beispiele (Mrkaja 2013):
Obwohl es ihr doch eher selten passiert, ist auch […] Kanzlerin, Angela Merkel(CDU), schon mal ein freudscher Versprecher passiert, über den sich der ehemalige hessische Ministerpräsident sicherlich nicht gefreut hat: „Lieber Roland Kotz … ähm … Koch!“
Auch der französische Ex-Präsident, Nicolas Sarkozy, hatte schon damals etwas zum EU-Problemkind Griechenland zu sagen: „Natürlich wollen wir Griechenland im Euroraum behalten. Es wäre fatal, den Menschen dort das Gefühl zu geben, sie seinen Europäer.“
Der Ex-Doktor Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) argumentierte in der Bundestagsdebatte zu seiner abgekupferten Doktorarbeit leider mit einem Sprichwort, dessen genauen Wortlaut er wohl nicht kannte: „Ich schmücke mich nicht mit fremden Fehlern.“
Diese Beispiele zeigen, wie sehr Freuds Konzept der Fehlleistungen die Allgemeinbevölkerung abseits der Couch erreicht hat und wie sehr es durchaus zur Belustigung beiträgt, aufzudecken was gewissermaßen verdeckt bleiben sollte. Doch welche Relevanz hat dieses Konzept in der psychoanalytischen Behandlung?
Überlegungen für die psychoanalytische Praxis
Nachdem in den vorangegangenen Kapiteln Bezug auf die Theorie sowie auf die alltägliche Relevanz der Thematik genommen wurde, möchte ich nun einen Blick auf die psychoanalytische Praxis werfen. Die Psychoanalyse hat mit der Aufdeckung, der Bedeutung von Fehlleistungen, einen Beitrag zu einer erkenntnisorientierten Sicht auf Fehler geleistet (vgl. Schneider 2014, S. 16). Dabei beschäftigen wir uns in der Praxis vor allem mit der Frage, warum eine Fehlleistung gerade an dieser Stelle passiert. Doch neben dem tieferen Sinn, die eine Fehlleistung zu Tage bringt, lohnt sich meiner Meinung nach besonders ein Blick auf die Frage „wie sie das tut“. Die amüsanten Beispiele des dritten Kapitels verdeutlichen dabei, dass das Unbewusste nicht nur eine finstere und ernste Angelegenheit ist. Es zeigt sich, dass genau wie beim Traum eine äußerst kreative Leistung vollbracht wird, welche überraschende Sprünge vollführt. Die Lebendigkeit und Lebenskraft, wie wir sie auch im Humor vorfinden, ist Teil unseres Selbst. In der Therapie kann es dabei von besonderer Bedeutung sein, wieder einen Zugang zu dieser lebendigen und gewitzten Quelle zu finden. Diese Quelle dürfte beispielsweise bei einer Depression - bildlich gesprochen - unter Trümmern und Geröll verschüttet sein. Sie bedarf bestimmt einer behutsamen Begleitung, welche Schritt für Schritt, die einzelnen Elemente sichtet und durcharbeitet. Doch mit dem Blick und der Voraussicht, dass diese Quelle existiert und nicht versiegt, sondern lediglich verschüttet ist, lässt sich wohl mit Zuversicht auf die therapeutische Arbeit blicken. Aus diesen Gründen ist es ein Apell, die lebendigen Energien des Selbst zu würdigen und sich ihrer innewohnenden Kraft einmal mehr bewusst zu werden.
Ausblick
Auch wenn man hätte meinen können, dass mit der Karikatur zu Beginn inhaltlich schon alles gesagt sei, stellt sich doch heraus, dass es einen genaueren Blick bedarf. Selbst wenn neuere linguistische Theorien, die sich mit dem Versprechen befassen, vielleicht die psychoanalytische Betrachtung Freuds an einigen Stellen relativieren, bleibt dabei eines ganz bestimmt zu sagen: Sowohl die leichten und amüsanten Aspekte lohnen sich aufgegriffen zu werden als auch die Betrachtung der Chancen und Möglichkeiten, welche sich in der therapeutischen Praxis bieten. In diesem Sinne bleibt nur eines zu sagen: Es lohnt sich in jedem Fall die Aufmerksamkeit, wenn Peinliches zum Vorschwein kommt!
Literaturverzeichnis
Freud, S. (1941): Gesammelte Werke. Chronologisch geordnet. Vierter Band. Zur Psychopathologie des Alltagslebens. Über Vergessen, Versprechen, Vergreifen, Aberglaube und Irrtum. London: Imago Publishing Co., Ltd.
Freud, S. (1942): Gesammelte Werke. Chronologisch geordnet. Zweiter und dritter Band. Die Traumdeutung. Über den Traum. London: Imago Publishing Co., Ltd.
Kruska, L. (2018): Donald W. Winnicott – Good enough is good enough! In: A. Sreck-Fischer (Hg.): Die frühe Entwicklung. Psychodynamische Entwicklungspsychologien von Freud bis heute. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
Laplanche, J.; Pontalis, J.-B. (1994): Das Vokabular der Psychoanalyse. Frankfurt am Main: Surkamp.
Mrkaja, D. (2013, 19. Nov.): Die Zwölf peinlichsten Versprecher von Politikern. In: Fokus Online. https://www.focus.de/kultur/buecher/lieber-roland-kotz-aehmkoch-die-zwoelf-peinlichsten-versprecher-von-politikern_id_3111140.html [abgerufen am 15. Jänner 2022].
Werner, C.; Langenmayr, A. (2005): Der Traum und die Fehlleistungen. Psychoanalyse und Empirie. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
Scheider, G. (2014): Es gibt nicht das Wahre im Unwahren, wohl aber das Richtige im Falschen. Über Fehler, Probleme, die sie machen und Fehler-Leistungen in der Psychoanalyse. In: Ebrecht-Laermann, A.; Löchel, E.; Nissen, B.; Picht, J. (Hrsg.): Jahrbuch der Psychoanalyse. Beiträge zur Theorie, Praxis und Geschichte. Fehler und Fehlleistungen (S. 15-48). Stuttgart: frommann-holzboog Verlag.